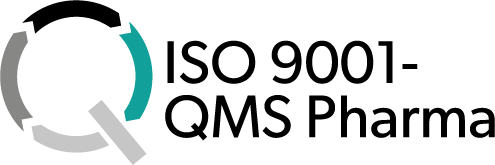Pestwurz
Heilpflanze seit dem Altertum
Seit vielen Jahrhunderten ist Pestwurz in der Volksheilkunde bekannt. Heute nutzt die moderne Pflanzenheilkunde die vielfältigen wissenschaftlich gesicherten Wirkungen der Pflanze.
Regenhut – griechisch petasos – nannten die griechischen Ärzte die Pflanze wegen ihrer bis mehr als einen halben Meter breiten Blätter. Der «Regenhut» steckt auch im lateinischen Gattungsnamen (Petasites) der Pestwurz. Ihren deutschen Namen erhielt die Pflanze im Mittelalter: Da die Pest häufig mit Schwitzkuren behandelt wurde, war man überzeugt, die schweisstreibenden Inhaltsstoffe des aus dem Wurzelstock der Pflanze gewonnenen Pulvers würden gegen die Pest helfen.
Heilpflanze seit dem Altertum
Die Pestwurz gehört zur Familie der Korbblütler. Die mehrjährige krautige Pflanze gedeiht in ganz Europa. Charakteristisch sind die kurz nach der Schneeschmelze erscheinenden rötlichen Blüten der medizinisch genutzten Echten Pestwurz (Petasites hybridus). Die Pestwurz wächst dort, wo es häufig feucht ist, etwa an Ufern von Bächen und Flüssen. Am Ende der Blütezeit öffnen sich die herzförmigen Blätter. Mit ihrer grauwolligen Behaarung auf der Unterseite ähneln sie denjenigen des Huflattichs, weshalb die Pestwurz auch Grossblättriger oder Falscher Huflattich genannt wird.
Die Blätter wurden schon in der Antike verwendet. Bei archäologischen Ausgrabungen im Hallstätter Salzbergwerk wurden 4000 Jahre alte gebündelte Petasites-Blätter gefunden. Man vermutet, dass sie als Toilettenpapier dienten, da die Inhaltsstoffe der Blätter gegen Wurmbefall helfen. Gesichert ist, dass Griechen und Römer die Blätter für die Behandlung bösartiger Geschwüre verwendeten.
In der Volksmedizin standen die hustenstillenden, schweiss- und harntreibenden Wirkungen der Pflanze im Vordergrund. Die frischen Blätter wurden zudem äusserlich zur Behandlung von Wunden und Hautverletzungen verwendet.
Pestwurz in der modernen Pflanzenheilkunde
Pestwurz wirkt krampflösend, schmerzlindernd, sodann gegen Entzündungen sowie antiallergisch. Als Einzelmittel oder kombiniert mit anderen Heilpflanzen findet sich Pestwurz in der Schweiz in Liste-D-Präparaten. Kombinationen mit Pestwurzwurzel sind bei Nervosität, Spannung, Unruhe und Verstopfung erhältlich, während Extrakte aus Pestwurzblättern zur Behandlung von Heuschnupfen eingesetzt werden.