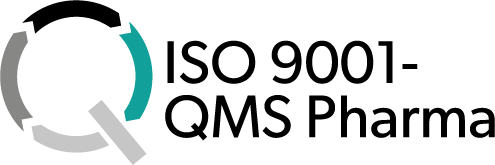Die 1000 Gesichter des Ekzems
Unter dem Begriff Ekzem wird eine grosse Gruppe entzündlicher Hautkrankheiten zusammengefasst, die sich auf unterschiedlichste Weise – von Rötungen und Schuppen bis hin zu Knötchen oder Blasen – unangenehm bemerkbar machen können.
Zu den häufigsten Ekzemen zählen das Kontaktekzem und das atopische Ekzem, auch bekannt als Neurodermitis. Kontaktekzeme, etwa ausgelöst durch Nickel in Schmuck oder Knöpfen, treten in der Schweiz bei ungefähr 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung irgendwann im Laufe ihres Lebens auf. Die Neurodermitis, welche durch eine Störung des Immunsystems, durch erbliche Veranlagung oder äussere Einflüsse wie Stress ausgelöst werden kann, ist weit verbreitet. In der Schweiz sind circa 20 Prozent der Kinder und bis zu fünf Prozent der Erwachsenen davon betroffen.
Seltener, aber ebenfalls gut bekannt ist das Austrocknungsekzem, von dem besonders ältere Menschen mit trockener Haut betroffen sind. Ebenso das «seborrhoische» Ekzem (von lateinisch «sebum» = Talg), an dem wahrscheinlich eine erhöhte Talgbildung der Talgdrüsen und ein Hefepilz beteiligt sind.
Weiters gibt es das «nummuläre» oder «münzförmige» Ekzem, das meist bei Erwachsenen zwischen 50 und 70 Jahren auftritt und möglicherweise eine Reaktion des Körpers auf eine bakterielle Infektion darstellt. Und schliesslich das «dyshidrotische» Ekzem, welches vor allem im Sommer durch den Schweiss auf der Haut begünstigt wird.
Behandlung: Pflege, Kortison, UV-Licht
Grundsätzlich bezeichnet ein Ekzem eine entzündlich veränderte Haut. Diese kann je nach Krankheit unterschiedlich aussehen: eher trocken oder nässend, mit Blasen-, Knötchen- oder Schuppenbildung. Das allergisch bedingte Hautekzem zum Beispiel hat meist mehrere Stadien: Nach der rötenden, juckenden Haut bilden sich Bläschen, die nachfolgend verkrusten; bei Abheilung der Haut sind dann oft Schuppen zu beobachten. In der chronischen Phase ist die Haut dann eher trocken und schuppig.
Die Behandlung von Ekzemen hängt von der Ursache ab. Beim Kontaktekzem kommen Kortison-haltige Cremes zum Einsatz. Zudem sollte der Auslöser, wenn möglich, vermieden werden.
Bei Neurodermitis ist die konsequent durchgeführte tägliche Hautpflege mit rückfettenden Substanzen das Wichtigste. Zusätzlich eingesetzt werden die Bestrahlung mit UV-Licht, Medikamente gegen den oft quälenden Juckreiz oder – in schweren Fällen – zur Unterdrückung des Immunsystems.
Beim Austrocknungsekzem hilft meist schon allein das Eincremen mit rückfettenden Salben; zudem sollten Betroffene zu häufiges Waschen mit Wasser und Seife vermeiden und darauf achten, ausreichend zu trinken.
Vom seborrhoischen Ekzem wiederum ist meist die Kopfhaut betroffen, die mit speziellen Shampoos behandelt wird; auch hier können Kortison-haltige Cremes eine Linderung verschaffen.
Gegen das dyshidrotische Ekzem hilft die Austrocknung der betroffenen Stellen (häufig Finger oder Füsse) in einem Bad mit Gerbstoffen, gefolgt von einer Kortison-Paste.
Beim nummulären Ekzem sollte, wenn möglich, die zugrundeliegende bakterielle Infektion behandelt werden; in vielen Fällen kommt hier eine antiseptische oder Kortison-haltige Creme zum Einsatz.
Die Haut beruhigen: weniger Stress, gesunde Ernährung
Die Haut gilt mit einer Oberfläche von rund 1,8 Quadratmetern als grösstes Organ des Körpers, aber auch als «Spiegel der Seele». Die Wechselwirkungen zwischen Haut und Psyche sind gut bekannt, etwa das Erröten bei Scham oder die Schweissentwicklung in angsteinjagenden Situationen.
Natürlich steht bei Hauterkrankungen die medizinische Behandlung im Vordergrund, doch oft können beispielsweise Entspannungsübungen ebenfalls zur Heilung beitragen. Zusätzlich sollte der äussere Stress der Haut durch aggressive Reinigungsprodukte etwa mit Konservierungsmitteln und Duftstoffen vermieden werden: Besser ist der Umstieg auf sanftere, pH-hautneutrale Produkte. Zu guter Letzt spielt auch die ausgewogene Ernährung eine Rolle, um die gesunde Stoffwechsellage und das Immunsystem zu unterstützen.