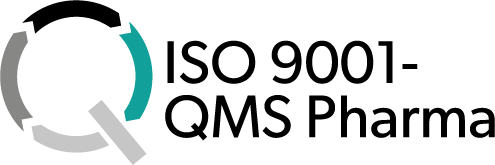Brustkrebs erkennen und behandeln
In der Schweiz wird jährlich bei 6500 Frauen und 50 Männern Brustkrebs diagnostiziert. Ab dem Alter von 50 Jahren erhöht sich das Risiko, an dieser Krankheit zu erkranken.
Früherkennung von Brustkrebs
Brustkrebs weckt bei vielen Frauen Ängste. Die Heilungschancen steigen, wenn die Krankheit frühzeitig erkannt wird. Anna Zahno, Leiterin des Informations- und Beratungsdienstes der Krebsliga Schweiz, rät Frauen daher, die Früherkennungsprogramme zu nutzen und auf Veränderungen ihrer Brüste zu achten.
Anzeichen für Brustkrebs
Viele Frauen reagieren alarmiert, wenn sie einen Knoten in der Brust oder der Achselhöhle ertasten. Doch Brustkrebs kann sich auch durch andere Veränderungen bemerkbar machen, wie zum Beispiel:
- Vergrösserung oder Veränderung der Form der Brust
- Hautveränderungen wie Rötungen oder Dellen
- Einziehen oder Entzündungen der Brustwarze
- Austritt von Flüssigkeit aus der Brustwarze, insbesondere bei Frauen, die nicht schwanger sind oder stillen
Es ist wichtig, auf solche Symptome zu achten und im Zweifelsfall einen Arzt aufzusuchen.
Anna Zahno empfiehlt Frauen, Veränderungen immer abklären zu lassen: «Manchmal steckt etwas Harmloses dahinter.» Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Brustkrebs nicht immer mit sichtbaren Veränderungen oder Knoten einhergeht. Daher sollten Frauen ab 50 Jahren auch ohne Symptome regelmässig eine Mammografie-Untersuchung durchführen lassen.
Risikofaktoren für Brustkrebs
Das Risiko für Brustkrebs kann genetisch bedingt erhöht sein, insbesondere durch die Mutationen der Gene BRCA1 und BRCA2. Etwa fünf bis zehn Prozent der Frauen mit Brustkrebs sind von diesen oder anderen bekannten Mutationen betroffen.
Brustkrebs kann jedoch auch familiär gehäuft auftreten, selbst ohne nachweisbare Genmutationen. Wenn eine Mutter, Schwester oder Tochter betroffen ist, steigt das eigene Risiko.
Es ist wichtig zu beachten, dass viele Frauen, die an Brustkrebs erkranken, weder genetisch noch familiär vorbelastet sind und einen gesunden Lebensstil führen.
Der Lebensstil spielt bei allen Krebserkrankungen eine Rolle. Eine ausgewogene Ernährung, regelmässige Bewegung, das Halten eines normalen Körpergewichts sowie der Verzicht auf Tabak und Alkohol können dazu beitragen, das Risiko zu reduzieren.
Diagnose von Brustkrebs
Bei Verdacht auf Brustkrebs werden in der Regel eine Mammografie sowie häufig ein Ultraschall durchgeführt. Anna Zahno erklärt: «Bei sehr dichtem Brustgewebe kann anstelle einer Mammografie auch ein MRI eingesetzt werden.»
Erhärtet sich der Verdacht auf Brustkrebs, erfolgt eine Gewebeprobeentnahme, um nach Brustkrebszellen zu suchen. Je nach Befund wird zudem überprüft, ob der Tumor bereits Metastasen in anderen Organen wie der Leber, Lunge oder den Knochen gebildet hat.
Behandlung von Brustkrebs
Die Therapie von Brustkrebs ist individuell und hängt vom Stadium der Erkrankung ab. Anna Zahno erläutert: «Kann der Tumor mit einem Sicherheitsabstand entfernt werden, wird oft brusterhaltend operiert und danach bestrahlt.»
Bei aggressiven Tumoren oder in fortgeschrittenen Stadien ist häufig eine Chemotherapie vor oder nach der Operation notwendig.
Für hormonabhängige Krebszellen wird eine antihormonelle Behandlung über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren empfohlen. Bei Brustkrebs mit Metastasen kommen je nach Situation Immuntherapien oder zielgerichtete Therapien zum Einsatz. Oft werden diese Behandlungen gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt.
Die Krebsliga empfiehlt, die Behandlung möglichst in einem zertifizierten Brustzentrum durchführen zu lassen, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.
Hilfreich während der Behandlung
Während der Therapie empfinden viele Frauen Bewegung, wie Yoga oder Walking, als wohltuend. Diese Aktivitäten können die Müdigkeit während der Behandlung verringern und das Risiko eines Rückfalls des Tumors senken. Einige Frauen fühlen sich wohler, wenn sich ihr Alltag nicht verändert, während andere mehr Zeit für sich selbst benötigen.
Brustamputation und -aufbau
Heute werden drei von vier Brustkrebspatientinnen brusterhaltend operiert, gefolgt von einer Bestrahlung. Laut Anna Zahno ist die Bestrahlung notwendig, um eventuell noch vorhandene Tumorzellen abzutöten. Eine Brustamputation (Mastektomie) ist oft erforderlich, wenn mehrere Knoten über die Brust verteilt sind, ein sehr grosser Tumor vorliegt, ein entzündlicher oder aggressiver Brustkrebs diagnostiziert wird oder der Tumor bereits in die Haut oder den Brustkorb eingewachsen ist.
Nach einer Brustamputation entscheiden sich manche Frauen, auf einen Brustaufbau zu verzichten und stattdessen Silikonprothesen im BH zu verwenden. Wenn der Wunsch nach einem Brustaufbau besteht, kann sofort nach der Mastektomie ein Silikonimplantat eingesetzt werden. Alternativ kann die Brust je nach Konstitution der Frau auch mit Eigengewebe, beispielsweise vom Bauch, rekonstruiert werden. Diese Option erfordert in der Regel mehrere Eingriffe und wird häufig nicht sofort nach der Mastektomie durchgeführt.
Überlebenschance bei Brustkrebs
Heute leben 88 Prozent der Frauen fünf Jahre nach der Brustkrebserkrankung. Dank besserer Behandlungsmethoden können immer mehr Frauen geheilt werden. Die Früherkennung spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sie die Heilungschancen erheblich erhöht. Anna Zahno weist jedoch darauf hin, dass trotz dieser Fortschritte immer noch Frauen an Brustkrebs sterben, insbesondere bei aggressiven Tumoren.
Hilfe bei Brustkrebs
Brustkrebs kann das Körperbild vieler Frauen stark beeinflussen. Viele haben Schwierigkeiten mit dem Haarverlust und der veränderten oder fehlenden Brust. Anna Zahno erklärt: «Brustkrebs greift das Frausein an und kann die Paarbeziehung belasten.»
Ein hilfreiches Angebot für viele Frauen ist der Austausch mit einer Fachperson des Krebstelefons. Auch wenn diese keine Therapieempfehlungen geben kann, tut es vielen gut, über ihre Sorgen und Ängste zu sprechen. Das Krebstelefon der Krebsliga Schweiz bietet Informationen und Beratung zu allen Fragen rund um Krebs und steht Betroffenen, Angehörigen und Interessierten kostenlos zur Verfügung.